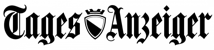Die grössten Missverständnisse um die Inflation
Inflation ist das Thema der Stunde. Höchste Zeit also, die wichtigsten Fragen und Missverständnisse zu klären.
Peter Rohner
Das Inflationsgespenst geht um. Immer mehr Leute befürchten, dass die beispiellosen Stimuli von Regierungen und Notenbanken das allgemeine Preisniveau nach oben treiben.
Google-Suchen nach Inflation sind in den USA auf einen Rekordwert gestiegen. Denn es zeichnet sich ein Teuerungsschub ab: Wegen des Basiseffekts beim Ölpreis und verschiedener Angebotsengpässe werde die durchschnittliche Inflation in den Industrieländern von aktuell knapp 1% bis Mai auf 2,6% zunehmen, schätzt Capital Economics. Aber wie genau entsteht Inflation, wie wird sie gemessen, und was bedeutet sie für den Arbeitsmarkt und die Börsen? Wir sind diesen grundlegenden Fragen nachgegangen, um einige Missverständnisse rund um die Inflation aus der Welt zu schaffen.
Missverständnis 1: Mehr Geld = mehr Inflation
Das Preisniveau steigt, wenn es zu viel Geld im Verhältnis zum Angebot von Waren und Dienstleistungen gibt. Oder wie der Ökonom Milton Friedman es formuliert hat: Inflation ist immer ein monetäres Phänomen. Sie kann nur entstehen, wenn die Geldmenge schneller zunimmt als die Gesamtproduktion. Aber das heisst nicht, dass Inflation entstehen muss, wenn die Geldmenge schnell zunimmt. Denn gemäss der Quantitätstheorie des Geldes kommt es auch darauf an, wie schnell das Geld zirkuliert. Ein Rückgang der Umlaufgeschwindigkeit kann den Anstieg der Geldmenge kompensieren. Nur wenn diese Verlangsamung der Zirkulation nicht geschieht, führt der Anstieg der Geldmenge bei gleichbleibender Produktion zu einem Preisauftrieb. Wie nach der Finanzkrise 2008/2009 ist das auch heute nicht der Fall: Die Umlaufgeschwindigkeit ist zusammengebrochen. Das heisst: Das meiste Geld, das die Regierungen und die Notenbanken ins System pumpen, kommt nicht in den Umlauf. Trotz staatlicher Bürgschaften halten die Banken mehr Reserven bei den Zentralbanken, statt mehr Kredite zu vergeben. Die Konsumenten legen das Geld auf die hohe Kante, statt es auszugeben. Seit den Sechzigerjahren gibt es keinen statistischen Zusammenhang zwischen Inflation und Wachstum der breiten Geldmenge mehr.
Missverständnis 2: Mehr Inflation oder mehr Arbeitslosigkeit
Die Vorstellung, dass es einen Trade-off zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit gibt, hält sich trotz schwindender Evidenz in den Köpfen. Ursprung dieser Idee ist die Phillips-Kurve, benannt nach dem Ökonomen William Phillips, der 1958 in historischen Daten einen negativen Zusammenhang zwischen Lohninflation und Arbeitslosigkeit festgestellt hatte. Paul Samuelson und Robert Solow modifizierten die Phillips-Kurve, indem sie die Lohnsteigerungen durch die Teuerung ersetzten. Wenn die Kapazitäten am Arbeitsmarkt ausgelastet sind und Arbeitskräfte nur schwer zu finden sind, steigen die Löhne und die Preise. Eine niedrigere Arbeitslosenquote kann man sich demnach durch mehr Inflation erkaufen, leiteten die Wirtschaftspolitiker daraus ab. Erst in Siebzigerjahren geriet dieses Dogma ins Wanken. Die Ausweitung der Geldmenge zur Stimulierung der Wirtschaft führte nicht zum Erfolg: Inflation und Arbeitslosigkeit stiegen miteinander. Heute ist von der Kurve nicht mehr viel übrig. Inflation und Arbeitslosenquote scheinen unkorreliert. Selbst wenn man die Abweichung von der natürlichen Arbeitslosenquote (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, NAIRU) als Arbeitsmarktvariable nimmt, gibt es über die letzten dreissig Jahre betrachtet kaum mehr einen Zusammenhang. Ein Grund für die Verflachung der Phillips-Kurve könnte in einem geldpolitischen Kurswechsel liegen. Die Notenbanken haben sich in den vergangenen Jahrzehnten so glaubwürdig dem Ziel der Preisstabilität verpflichtet, dass die Inflationserwartungen fest verankert sind.
Missverständnis 3: Inflation wird falsch gemessen
Im Februar ist der Landesindex der Konsumentenpreise (Lik) im Vergleich zum Vorjahresmonat 0,5% gesunken. Aber viele Bürger fragen sich, warum im Alltag nichts von Deflation zu spüren ist. Mieten, Krankenkassenprämien und Zigaretten – es wird doch alles immer teurer! Die gefühlte Inflation ist in der Regel höher als die gemessene, in der Eurozone macht der Unterschied sogar über 5 Prozentpunkte aus. Aber auch hierzulande klafft eine Lücke. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Musterwarenkorb des durchschnittlichen Konsumenten von dem der einzelnen Haushalte stark abweichen kann. Zudem werden Preiserhöhungen eher wahrgenommen und in Erinnerung behalten als eine leichte Preisreduktion. Total falsch gemessen wird aber nicht, schliesslich werden die Warenkörbe jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Und wenn es Messfehler gibt, dann sollten sie den Inflationsindex nicht einseitig verzerren – die Fehler heben sich mehr oder weniger auf. Ein grosser Ausgabenposten: die Mieten. Sie sind im Lik enthalten. Allerdings ist der Mietindex in den vergangenen fünf Jahren weniger als 1% jährlich gestiegen. Denn die Bestandsmieten sind im Unterschied zu den Angebotsmieten mit dem Absinken des Referenzzinses teils gesunken. Was in der Inflationsmessung allerdings tatsächlich fehlt, sind die Immobilienpreise. Die Kosten für selbstgenutztes Wohneigentum sind in der Teuerungsstatistik nur indirekt und partiell enthalten. Viele Statistikämter sind zögerlich, wenn es darum geht, die Liegenschaftspreise aufzunehmen. Denn streng genommen handelt es sich bei einem Wohnungskauf um eine Investition, nicht um Konsum. Auch die Krankenkassenprämien fehlen im Warenkorb der Inflationsmesser. Der Grund dafür: Es handelt sich um eine Finanzierungsform für Gesundheitskosten. Die Prämien fliessen im Schadenfall zurück. Anstelle der Prämien sind die damit finanzierten Leistungen wie Arzt- und Spitalkosten sowie Medikamente im Lik enthalten.
Missverständnis 4: Schuld ist der Ölpreis
Ein steigender Erdölpreis drückt aufs Portemonnaie. Benzin, Heizöl sowie Flugreisen und andere energieintensive Produkte werden teurer. Das Auf und Ab des Rohölpreises erklärt einen grossen Teil der Entwicklung der Konsumentenpreise. Doch der Einfluss hat in den letzten Jahrzehnten nachgelassen, da Dienstleistungen ein grösseres Gewicht im Warenkorb erhalten haben und ihre Produktion weniger ölintensiv ist. Zudem dämpfen fixe Steuern und Abgaben den Effekt der Preisschwankung. Beim Benzin in der Schweiz zum Beispiel macht der Einkaufspreis in Rotterdam nur ein Viertel des Preises an der Zapfsäule aus. Ausserdem beeinflusst der Ölpreis die Inflation nur kurzfristig. Die langfristigen Inflationserwartungen sind von der Preisbildung an den Energiemärkten kaum tangiert. Auch jetzt sind die Inflationserwartungen recht stabil, obwohl die Rohstoffpreise kräftig gestiegen sind. Anscheinend haben viele Wirtschaftsakteure Zweifel an einem neuen Superzyklus an den Rohwarenmärkten. In den kommenden Monaten wird der gestiegene Ölpreis – vor einem Jahr notierte die Ölsorte Brent unter 20 $ pro Fass – die Inflationsrate aufblähen. Doch ewig hält der Preisanstieg nicht an – dann wird der Basiseffekt entgegengesetzt wirken.
Missverständnis 5: Inflation ist Gift für die Börse
Massive Geldentwertung, kaum Planungssicherheit und schädlich hohe Zinsen. Mit solchen Kalamitäten wird die Inflation oft in Verbindung gebracht. Entsprechend unbeliebt ist sie bei den Anlegern. Geprägt ist diese Sichtweise von den Erfahrungen der Siebzigerjahre, als hohe Inflation, aber wirtschaftliche Stagnation herrschte. Damals wurde der Begriff Stagflation geprägt. Dieses Phänomen bescherte Aktionären nach Abzug der Inflation herbe Verluste. Aber das heisst nicht, dass mehr Teuerung verheerend für die Börsen sein muss: Wenn gleichzeitig die Wirtschaft kräftig wächst, überwiegt der positive Effekt auf die Unternehmensgewinne. Da man mit Aktien einen Anteil an materiellen und immateriellen Unternehmenswerten besitzt, gelten sie als Realanlagen. Eine Auswertung des Credit Suisse Research Institute in rund zwei Dutzend Ländern und über hundert Jahre zeigt, dass der reale Aktienertrag nur bei sehr hoher Inflation negativ war. Problematisch wird es erst, wenn die Notenbanken zu drastischen Zinsmassnahmen gezwungen werden und die Bewertungen kollabieren.
Missverständnis 6: Bei hoher Inflation helfen Linkers
Angesichts der Teuerungsdebatte erstaunt es nicht, dass inflationsgeschützte Anleihen als Alternative zu normalen Bonds gefeiert werden. Bei den sogenannten Linkers sind der Nennwert und meist auch die Couponauszahlung an den Konsumentenpreisindex gebunden. Der Anleger akzeptiert eine geringere Rendite, dafür muss er sich keine Sorgen über eine höhere Teuerung machen. Seine Performance ist damit auch real – nach Abzug der Inflation – festgezurrt. Das heisst aber nicht, dass man solche Instrumente erwerben sollte, wenn die Teuerung oder die Inflationserwartungen bereits hoch sind. Denn dann ist die Rendite im Vergleich zu normalen Papieren sehr gross. Inflationsgeschützte Bonds lohnen sich nur, wenn die tatsächlich eintretende Konsumentenpreisinflation über der eingepreisten Erwartung (Break-Even-Inflation) liegt. Bezogen auf die USA bedeutet dies derzeit: Nur wer annimmt, dass die Teuerung über die kommenden fünf Jahre im Schnitt über 2,5% liegt, fährt mit Linkers besser als mit normalen Treasuries. In den vergangenen zehn Jahren lag die Teuerung in den USA im Mittel unter diesem Wert. Auch das Inflationsziel der US-Notenbank liegt mit 2% darunter.
Erschienen in: Finanz und Wirtschaft, Nr. 23, 24. März 2021
Themenspezifische Specials
Mit themenspezifischen Specials, welche als zusätzlicher Zeitungsbund erscheinen, bietet der Tages-Anzeiger ihren Lesern regelmässig einen attraktiven Mehrwert.